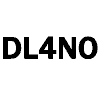
Blackout - gefährlich? |
|
Ein Blackout ist ein großräumiger Stromausfall, der nicht innerhalb weniger Stunden endet. Ich rede hier nicht von den kleinen Zwischenfällen im Niederspannungs- oder Mittelspannungsnetz, wenn beispielsweise mal wieder ein Bagger ein Stromkabel beschädigt. Solche Vorfälle sind alltäglich und betreffen mal einen Straßenzug oder so. Meist sind sie innerhalb von Stunden beseitigt und es ist halt ärgerlich, wenn das Mittagessen nicht pünktlich auf dem Tisch steht. Ich rede hier auch nicht vom Stromausfall in Berlin-Köpenick im Frühjahr 2020 [6], als 31 Stunden lang der Strom weg war: Dieses Ereignis legte natürlich viele Schwachpunkte offen, als beispielsweise ein Krankenhaus samt Intensivabteilung verlegt werden musste: Wer etwas brauchte, konnte sich aufs Fahrrad setzen und ein paar Kilometer weiter ganz normal einkaufen. Ich weiß auch nichts von einem Zusammenbruch der Wasserversorgung. Warum ist ein Blackout gefährlich?Ohne Strom geht bei uns nichts mehr. Das Büro für Technik-Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag hat das Thema schon 2010 untersucht [3]. Etwas verklausuliert steht da: Etwa am 5. Tag eines Blackout bricht die öffentliche Ordnung zusammen. Die Wasserversorgung funktioniert in viele Fällen noch typisch zwei Tage. Aber fast alle Einkaufsmöglichkeiten fallen sofort weg: Keine Kasse funktioniert mehr, die meisten Ladenlokale sind dunkel, die Kühlung fällt aus, die Pumpen in der Tankstelle gehen nicht mehr. Ohne Wasser kann man nur 3 Tage überleben. Viele Menschen sind auf Strom angewiesen, z.B. weil sie ohne Aufzug nicht aus dem Haus kommen oder auf ein medizinisches Gerät angewiesen sind. Hilfs- und Pflegedienste fallen aus, weil die Pfleger erst garnicht zum Dienst kommen und Großküchen ohne Strom nicht funktionieren. Ein längerer Stromausfall kann für viele Menschen schnell lebensbedrohend werden. Die Versorgung der Bevölkerung bricht zusammen. Elektronische Kommunikation bricht spätestens innerhalb von Stunden zusammen. Ein Blackout ist also viel zu gefährlich, um unvorbereitet hinein zu stolpern. Wie kommt es zu einem Blackout?Kritisch wird es, wenn im Hochspannungsnetz plötzlich Unterbrechungen auftreten oder kritische Kraftwerke ausfallen. Ein Blackout wird also im Hochspannungsnetz ausgelöst. Die meisten Beschwichtigungsversuche verweisen auf den SAIDI, z.B. [22]. Der gibt aber, etwas vereinfacht nur an, wie oft ein Bagger ein Stromkabel im Verteilnetz zerstört hat. Das Stromnetz ist grundsätzlich nach dem Prinzip des einfachen Fehlers aufgebaut: Wenn irgendwo eine einzelne Komponente ausfällt, darf das keinen Ausfall verursachen. Beispielsweise werden, zumindest in den Siedlungszentren, Stromnetze immer von zwei Seiten her eingespeist. Die Verteilleitungen enden beispielsweise nicht beim letzten Teilnehmer, sondern verlaufen von einer Umspannstation zur nächsten. So kann man die eine Umspannstation außer Betrieb nehmen, ohne dass die Verbraucher etwas merken. Deshalb merken wir auch von den meisten Störungen nichts. Bei den Netzbetreibern gehen dann aber die roten Lampen an: Jedes weitere Problem gefährdet das Netz. Eine solche Situation gab es beispielsweise am 8. Januar 2021 [2]. Mittlerweile treten solche Situationen immer wieder auf [105]. Dabei ist das europäische Verbundnetz nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung: Je größer der Verbund ist, um so größere Probleme kann das System aushalten und hoffentlich wegstecken. Die 6 GW, die am 8. Januar 2021 plötzlich nicht mehr fließen konnten, entsprechen der Leistung von sechs großen Kraftwerksblöcken – egal ob AKW oder Braunkohle-Kraftwerke. So entsteht ein BlackoutWenn aber mehrere Probleme zusammen kommen, dann kommt es leicht zu einer Ausfallkette: Eine Komponente fällt aus oder muss sich abschalten. Das überlastet die nächste, die dann auch ausfällt – ein Dominostein nach dem anderen fällt. Dann zerfällt das europäische Verbundnetz in Segmente. Wird diese Kette nicht frühzeitig gestoppt, werden Kraftwerke ihre Leistung nicht mehr los und müssen vom Netz gehen. Sehr viele Kraftwerke kann man nicht im Leerlauf betreiben, sondern muss sie mit Notkühlung herunterreißen. Große Teile des Verbundnetzes brechen zusammen, wir haben einen Blackout. Der Netzaufbau nach einem Blackout dauert längerAnschließend ist es höchst kompliziert, das Netz wieder in Betrieb zu nehmen [76]: Nur recht wenige Kraftwerke sind schwarzstartfähig.Die erzeugen dann den Strom, mit dem man die anderen Kraftwerke wieder hochfahren kann – ein Vorgang, der bei einem wirklich kalten Kraftwerk eine Woche oder länger dauern kann. Große Wärmekraftwerke haben den Strombedarf einer Kleinstadt. Erst nach dem Hochfahren speist auch dieses Kraftwerk Strom ins Netz, mit dessen Hilfe auch das Stromnetz überwacht und gesteuert und andere Kraftwerke hochgefahren werden können. Irgendwann ist dann wieder so viel Strom da, dass man langsam die Verbraucher wieder anschließen kann. Das kann aber auch nur Schritt für Schritt passieren, weil ja überall die Lichter eingeschaltet sind, die Kühlschränke ihre Kompressoren eingeschaltet haben usw. – beim Einschalten gibt es erst mal einen großen Stromstoß. Langer Rede kurzer Sinn: Ein großflächiger Stromausfall kommt plötzlich und dauert leicht mal 10 Tage. In diese Zeit geht in den betroffenen Gebieten wortwörtlich nichts mehr! Bis dann die ganze Logistik bis zum Supermarkt auch nur annähernd wieder funktioniert, geht wohl nochmals mindestens eine Woche ins Land.
Das sind Auswirkungen, die nur ganz kurzfristig ohne schwere Folgen bleiben. Sehr schnell ist jeder allein auf sich selbst angewiesen. Deshalb ist es wichtig, sich auf drei Wochen ohne Strom, ohne Einkaufsmöglichkeit, ohne Telefon und ohne Internet einzustellen. |
|
Alexander von Obert * http://www.dl4no.de/thema/blackout1.htm Letzte Änderung: 11.01.23 (redaktionell überarbeitet) |