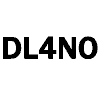
Drei Jahre "Notfunk ready" |
|
Seit 2017 beschäftige ich mich mit Solarenergie. Lange plätscherte das als Hobbyprojekt vor sich hin – ich stand noch voll im Beruf und war häufig die ganze Woche unterwegs. Daraus entstanden das Kapitel Stromversorgung und meine erste Veröffentlichung in der Zeitschrift Funkamateur [1]. Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung nach in der Hoffnung, anderen bei der Entwicklung ihres Konzeptes zu helfen. Das Grundkonzept plante ich anhand meiner Erfahrungen, aber vieles ergab sich über die Jahre auch aus Gelegenheiten. Für mich ergibt sich langam ein Ganzes, dem vor allem so einiges an Automatisierung fehlt. Bislang muss ich mich mehrmals in der Woche um meine Notstromversorgung kümmern. Covid und Lockdowns brachten uns zur Erkenntnis, dass wir mehr für Vorratshaltung und ähnliche Vorsorge tun sollten, was zum Kapitel Katastrophenvorsorge in dieser Website führte. Nach einem internationalen Ereignis im Februar 2022 wollte ich auf Basis meiner gewonnenen Erfahrungen eine Notstromversorgung aufbauen, die nicht nur einen Funkkoffer versorgt. Inhalt
Pflichtenheft der neuen NotstromversorgungDie wichtigsten Stromverbraucher in unserem Haushalt während einer Katastrophe sind Kühlschrank und Funkanlage, plus ausreichend Möglichkeiten zum Landen von Geräten mit USB-Anschluss: Lampen, Radios, Smartphones usw. Als Existenzminimum definierte ich 500 Wh/Tag, also rund 4 kWh pro Woche. Diese Zeit wollte ich mit Akkus überbrücken. 12,8 V als Systemspannung bereitet spätestens ab Leistungen von 1 kW ziemliche Probleme. Meinen 2-kW-Wechselrichter musste ich mit 32 mm2 Querschnitt anschließen. Der 200-Ah-Schalter davor war reichlich teuer und wird trotzdem gut warm. Das zentrale Argument für 12,8 V war der direkte Betrieb der Funkanlage ohne Spannungswandler. Die einfachste Möglichkeit wäre gewesen, die Akkus bereitzuhalten und zweimal im Jahr nachzuladen. Es gab zwei Gründe, daraus ein Solar-Inselnetz zu machen: Ich wollte die Erkenntnise aus meinen oben geschilderten Experimenten nutzen und die netzunabhängige Nutzungszeit verlängern. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich innerhalb einer Woche auch etwas Solarstrom ernten kann, sind recht gut. Ausbau und EinsparungDer Ausbau begann mit zwei LFP-(LiFePO4)-Akkus mit je 12,8 V/150 Ah. Zwei Akkus wurden es aus zwei Gründen: Auch wenn LFP-Akkus nur ein Drittel ähnlich großer Bleiakkus wiegen, sind sie trotzdem reichlich unhandlich. Zudem hatte ich von Anfang an das Thema Redundanz im Blick. Nicht nur, dass die Notstromversorgung auch nach dem Ausfall eines Akkus weiter funktionsfähig wäre. Ich kann auch im laufenden Betrieb einen Akku abklemmen – um ihn zu prüfen, auszutauschen oder die Notstromversorgung umzubauen. 
Parallel kaufte ich drei 335-Wp-Solarmodule. Zwei davon schaltete ich in Serie, so dass ich zu rund 70 V Solarspannung kam. Die konnte ich ohne große Verluste mit 2,5-mm2-Leitungen in den Keller führen. Das dritte sollte das Shack versorgen. Die Solarmodule schraubte ich vertikal an die mit Holz verkleidete Hauswand. Das sparte mir nicht nur mehrere 100 EUR für den Unterbau, sondern hat auch zwei technische Vorteile: Es bleibt kein Schee auf ihnen liegen und ich kann über das Winterhalbjahr mehr Strom ernten. Im Sommer weiß ich über Wochen sowieso kaum, wohin mit der Solarenergie. Ins Netz einspeisen war für mich kein Weg, schon weil ich den Netzbetreiber aus meinem Experimentiersystem raushalten wollte. Den Strom will ich möglichst gleichmäßig über das ganze Jahr ernten können. Einen Strich durch die Rechnung machen mir die rund 20 m hohen Bäume südlich meines Gartens. Von Anfang November bis Mitte Februar steht das Haus mehr oder weniger vollständig im Schatten. Deshalb war auch eine übliche Solaranlage mit 10 kWp oder so für mich nie ein Thema. Das nebenstehende Bild wurde Weihnachten aufgenommen. Ich habe den Kontrast verstärkt, damit man die Schatten der Baumkronen besser sieht. Tatsache ist, dass dieser Halbschatten die Ausbeute um mehr als die Hälfte reduziert. Projekt KühlschrankDie oben erwähnten Akkus landeten im Keller mit dem primären Ziel, den Kühlschrank und kurzzeitig Küchengeräte zu versorgen. Ein funktionierender Kühlschrank erleichtert die Vorratshaltung beträchtlich. Unser Kühlschrank war gut 10 Jahre alt und brauchte, samt Wechselrichter, fast 1 kWh pro Tag – zu viel für die oben angepeilten 500 Wh/Tag. Das führte zu einem Ringtausch: Unser schätzungsweise 30 Jahre alter Notfall-Kühlschrank im Keller landete auf dem Wertstoffhof, der Kühlschrank aus der Küche im Keller. Der neue Kühlschrank mit Energieklasse A hat mehr Raum als der alte und braucht, samt Verlusten des Wechselrichters, rund 400 Wh/Tag. Selbst bei reinem Netzbetrieb lohnte sich die zusätzliche Ausgabe für die hohe Energieklasse über die Nutzungsdauer durch die Stromeinsparung. Umstieg auf neue Technik im ShackIm Shack sammelten sich die ganzen Blei-Gel-Akkus – letztlich nominell 2 x 110 Ah (zusammen 30 EUR, weil sie im ursprünglichen Einsatz nicht mehr einen ganzen Tag durchhielten), und 30 Ah, auf einem AFU-Flohmarkt gekauft. Die nächste Entwicklungstufe wurde vom zunehmenden Verfall der Blei-Gel-Akkus ausgelöst: Selbst die alten Solarmodule bekamen die Akkus schnell voll, aber bis zum Morgen waren die Akkus mehr oder weniger leer. Da half auch die 4-mm2-Leitung von den Akkus im Keller nicht mehr weiter: Durch die höhere Systemspannung der LFP-Akkus im Keller wurden die Blei-Akkus im Shack mit bis zu 1 A nachgeladen. Ende des Blei-ZeitaltersAlso beschaffte ich noch zwei LiFePO4-Akkus, diesmal mit jeweils 100 Ah Kapazität. Das ist die gängigste und billigste Bauform. Beim lokalen Altmetallhändler lieferte ich insgeamt 130 kg Blei-Gel-Akkus ab. Damit wurde auch der Ladestrom aus dem Keller wesentlich kleiner. In der Übergangszeit hilft ein Gleichspannungs-Aufwärtswandler, der bei Bedarf etwas Energie aus dem Keller ins Shack pumpt. Von den alten Solarmodulen (im Bild die untere Reihe) blieb nur das rechte in Betrieb, das parallel mit dem linken 335-Wp-Modul das Shack versorgt. Die Kombination ist nicht optimal, liefert aber mehr Energie als nur ein Modul: Das 335-Wp-Modul ist bis zum frühen Nachmittag in der Sonne, wenn das alte Modul erst voll in die Sonne kommt. Neuer Computer spart StromDer größte Stromverbraucher im Shack war der Windows-Kompaktcomputer, der zudem mit 19 V zu betreiben war. Dafür benutzte ich einen Spannungswandler, mit dem man Notebooks auch im Auto, Wohnmobil usw. betreiben kann. Dann lief mir der Testbericht eines Miniaturrechners mit N100 CPU über den Weg. Auf einem Bild war klar zu erkennen, dass der Rechner mit 12 V betrieben wurde. In dem Rechner war wohl nichts drin, das direkt mit 12 V betrieben wurde. Ich ging davon aus, dass der Spannungswandler im Eingang auch mit den 13,8 V klarkommen würde, die maximal vom Akku ankommen würden. Das Spiel ging auf, zu dem Rechner gibt es hier eine eigene Seite. Der Strombedarf meiner Funkanlage sank auf unter 300 Wh/Tag bei Dauerbetrieb. Damit bin ich an meinem Ziel, im Ernstfall auch über Wochen netzunabhängig Notfunk machen zu können. Die Situation des AFU-NotfunksEhe ich meine konkrete Ausrüstung planen konnte, musste ich mich erst einmal mit den wahrscheinlichen Randbedingungen eines Notfunk-Einsatze beschäftigen. Im Lauf diverser Jahre, mit viel Recherche und einer Reihe von Gesprächen mit einschlägigen Fachleuten, kam ich zu einem deutlich anderen Ergebnis als der organisierte Amateurfunk. Ich bin auch in einem Alter, wo man gerade bei Chaos das Haus nicht mehr verlässt. Es gibt die völlig veraltete IARU-Richtlinie zum Notfunk [2], von der sich auch der DARC noch nicht lösen wollte. Das Grundaxiom all dieser Aktivitäten ist, dass Notfunk in erster Linie aus Unterstützungsfunktionen für Hilfsdienste und staatliche Institutionen besteht. Zu Zeiten des analogen BOS-Funks war das richtig, denn die meisten der BOS-Organisationen konnten per Funk nicht zusammenkommen. Heute, mit TETRA, geschlossenen Mobilfunketzen, Satellitenfunk usw. gibt es dieses Problem kaum noch. Entsprechend wurden meines Wissens in Deutschland seit vielen Jahren keine Funkamateure mehr von THW usw. angefordert. Ein spezieller Aspekt des Amateurfunks disqualifiziert uns auch für solche Einsätze: Wir müssten die jederzeitige Einsatzfähigkeit innerhalb von Stunden sicherstellen. Das würde, zumindest für Kernteams, Rufbereitschaft rund um die Uhr erfordern. Wenn man mal mit Notfunkreferenten aus verschiedenen Ortsverbänden und Distrikten gesprochen hat, verliert man hier jede Illusion. Meine Konsequenz ist die Konzentration auf den Welfare-Traffic, denn um die Kommunikation der Zivilbevölkerung kümmern sich die Hilfsdienste ausdrücklich nicht. Wir sind viele und wenn etwas passiert, sind wir schon da. Meine Folgerungen aus dieser Analyse:
Damit überschreite ich ganz bewusst den Rahmen des Amateurfunks. Zu meinen wichtigsten Ansprechpartnern gehören Rathaus, Landratsamt usw. Dabei sehe ich mich als Teil der Bemühungen um Resilienz in der Gemeinde. Amateurfunk bleibt hier ganz bewusst im Hintergrund. Kaum Strukturen im Großraum MünchenAuf der Amateurfunk-Tagung 2025 schilderte der DV-C den aktuellen Stand:
Weitergehende Strukturen oder Regeln gibt es aber noch nicht. So lange komme ich auch nicht weiter als bis Notfunk ready. Bis dahin empfehle ich mein Notfunk-Blog. Meine konkrete AusrüstungPrimär will ich Notfunk im lokalen bis regionalen Bereich betreiben können, etwa bis 500 km Entfernung. Mit einem IC-705 habe ich ein leistungsfähiges QRP-Funkgerät gewählt, das alle naheliegenden Bänder abdeckt und einfach per USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden kann. Falls die 10 W mal nicht ausreichen, habe ich auch eine 40-W-PA für Kurzwelle. Bislang kann ich die konventionellen Bänder 80/40/20/10m nutzen. Die 80m-Antenne ist elektrisch vielleicht 3 m über dem Boden und funktioniert ans NVIS-Antenne recht ordentlich. Die anderen KW-Bänder nutze ich mit einer speziellen Windom-Antenne, die mit 22 m Länge gerade noch in meinen Garten passt. Damit kann ich tagsüber mit guter Wahrscheinlichkeit den deutschsprachigen Raum und den Bereich bis etwa 1000 km Entfernung erreichen. Ich konzentriere mich auf digitale Betriebsarten, weil meine Station so auch ohne mich sinnvolle Dienste anbieten kann.
Demnächst will ich etwas an meinen VHF/UHF-Antennen tun, damit ich vernünftig nach München hinein komme. Die meisten Funkamateure dort sitzen in einer Mietswohnung in einem mehr oder weniger großen Haus, wo sie die Antenne auf dem Balkon verstecken müssen. Keine guten Voraussetzungen, um auf einer Direktfrequenz mehr als 5 km zu überbrücken. 3 km davon sind schon der Abstand von mir bis zum Bebauungsrand von München. Verweise
|
|
Alexander von Obert * http://www.dl4no.de/thema/dreijahr.htm Letzte Änderung: 16.08.25 (Abschnitt 'weitere Erfahrungen' verschoben) |